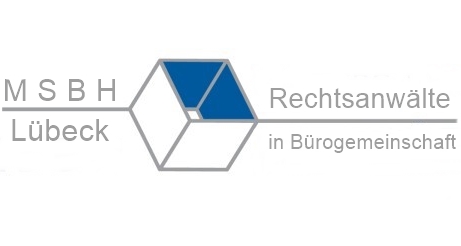Arbeitsrecht
Ewiger Urlaub? Ja!
Der Anspruch auf gesetzlichen Mindesturlaub aus einem Urlaubsjahr, in dem der Arbeitnehmer tatsächlich gearbeitet hat, bevor er aus gesundheitlichen Gründen an der Inanspruchnahme seines Urlaubs gehindert war, erlischt regelmäßig nur dann nach Ablauf eines Übertragungszeitraums von 15 Monaten, wenn der Arbeitgeber ihn rechtzeitig in die Lage versetzt hat, seinen Urlaub in Anspruch zu nehmen. Dies folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des § 7 Abs. 1 und Abs. 3 BUrlG. Der als schwerbehinderter Mensch anerkannte Kläger ist bei der beklagten Flughafengesellschaft als Frachtfahrer im Geschäftsbereich Bodenverkehrsdienste beschäftigt. In der Zeit vom 1. Dezember 2014 bis mindestens August 2019 konnte er wegen voller Erwerbsminderung aus gesundheitlichen Gründen seine Arbeitsleistung nicht erbringen und deshalb seinen Urlaub nicht nehmen. Mit seiner Klage hat er ua. geltend gemacht, ihm stehe noch Resturlaub aus dem Jahr 2014 zu. Dieser sei nicht verfallen, weil die Beklagte ihren Obliegenheiten, an der Gewährung und Inanspruchnahme von Urlaub mitzuwirken, nicht nachgekommen sei. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers, die wegen streitiger Urlaubsansprüche aus weiteren Jahren aus prozessualen Gründen zurückzuweisen war, hatte hinsichtlich des Resturlaubs aus dem Jahr 2014 überwiegend Erfolg. Entgegen der Auffassung der Beklagten verfiel der im Jahr 2014 nicht genommene Urlaub des Klägers nicht allein aus gesundheitlichen Gründen. Grundsätzlich erlöschen Urlaubsansprüche nur dann am Ende des Kalenderjahres (§ 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG) oder eines zulässigen Übertragungszeitraums (§ 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG), wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor durch Erfüllung sog. Aufforderungs- und Hinweisobliegenheiten in die Lage versetzt hat, seinen Urlaubsanspruch wahrzunehmen, und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat. Besonderheiten bestehen, wenn der Arbeitnehmer seinen Urlaub aus gesundheitlichen Gründen nicht nehmen konnte.
Nach bisheriger Senatsrechtsprechung gingen die gesetzlichen Urlaubsansprüche in einem solchen Fall - bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit - ohne weiteres mit Ablauf des 31. März des zweiten Folgejahres unter („15-Monatsfrist“). Diese Rechtsprechung hat der Senat in Umsetzung der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs aufgrund der Vorabentscheidung vom 22. September 2022 (- C-518/20 und C-727/20 - [Fraport]), um die ihn der Senat durch Beschluss vom 7. Juli 2020 (- 9 AZR 401/19 (A) -) ersucht hat, weiterentwickelt. Danach verfällt weiterhin der Urlaubsanspruch mit Ablauf der 15-Monatsfrist, wenn der Arbeitnehmer seit Beginn des Urlaubsjahres durchgehend bis zum 31. März des zweiten auf das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres aus gesundheitlichen Gründen daran gehindert war, seinen Urlaub anzutreten. Für diesen Fall kommt es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber seinen Mitwirkungsobliegenheiten nachgekommen ist, weil diese nicht zur Inanspruchnahme des Urlaubs hätten beitragen können.
Anders verhält es sich jedoch, wenn der Arbeitnehmer - wie vorliegend der Kläger - im Urlaubsjahr tatsächlich gearbeitet hat, bevor er voll erwerbsgemindert oder krankheitsbedingt arbeitsunfähig geworden ist. In dieser Fallkonstellation setzt die Befristung des Urlaubsanspruchs regelmäßig voraus, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer rechtzeitig vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit in die Lage zu versetzt hat, seinen Urlaub auch tatsächlich zu nehmen. Der für das Jahr 2014 im Umfang von 24 Arbeitstagen noch nicht erfüllte Urlaubsanspruch konnte danach nicht allein deshalb mit Ablauf des 31. März 2016 erlöschen, weil der Kläger nach Eintritt seiner vollen Erwerbsminderung mindestens bis August 2019 aus gesundheitlichen Gründen außerstande war, seinen Urlaub anzutreten. Der Resturlaub blieb ihm für dieses Jahr vielmehr erhalten, weil die Beklagte ihren Mitwirkungsobliegenheiten bis zum 1. Dezember 2014 nicht nachgekommen ist, obwohl ihr dies möglich war.
Quelle: Pressemitteilung Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. Dezember 2022 - 9 AZR 245/19 -
Entgeltgleichheit von Männern und Frauen
Eine Frau hat Anspruch auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit, wenn der Arbeitgeber männlichen Kollegen aufgrund des Geschlechts ein höheres Entgelt zahlt. Daran ändert es nichts, wenn der männliche Kollege ein höheres Entgelt fordert und der Arbeitgeber dieser Forderung nachgibt.
Die Klägerin ist seit dem 1. März 2017 bei der Beklagten als Außendienstmitarbeiterin im Vertrieb beschäftigt. Ihr einzelvertraglich vereinbartes Grundentgelt betrug anfangs 3.500,00 Euro brutto. Ab dem 1. August 2018 richtete sich ihre Vergütung nach einem Haustarifvertrag, der ua. die Einführung eines neuen Eingruppierungssystems regelte. Die für die Tätigkeit der Klägerin maßgebliche Entgeltgruppe des Haustarifvertrags sah ein Grundentgelt iHv. 4.140,00 Euro brutto vor. In § 18 Abs. 4 des Haustarifvertrags heißt es: “Für den Fall, dass das neue tarifliche Grundentgelt das bisherige tarifliche Entgelt (…) überschreitet, erfolgt die Anpassung um nicht mehr als 120,00 €/brutto in den Jahren 2018 bis 2020 (Deckelungsregelung). In Anwendung dieser Bestimmung zahlte die Beklagte der Klägerin ab dem 1. August 2018 ein Grundentgelt iHv. 3.620,00 Euro brutto, das in jährlichen Schritten weiter angehoben werden sollte. Neben der Klägerin waren als Außendienstmitarbeiter im Vertrieb der Beklagten zwei männliche Arbeitnehmer beschäftigt, einer davon seit dem 1. Januar 2017. Die Beklagte hatte auch diesem Arbeitnehmer ein Grundentgelt iHv. 3.500,00 Euro brutto angeboten, was dieser jedoch ablehnte. Er verlangte für die Zeit bis zum Einsetzen einer zusätzlichen leistungsabhängigen Vergütung, dh. für die Zeit bis zum 31. Oktober 2017 ein höheres Grundentgelt iHv. 4.500,00 Euro brutto. Die Beklagte gab dieser Forderung nach. Nachdem die Beklagte dem Arbeitnehmer in der Zeit von November 2017 bis Juni 2018 - wie auch der Klägerin - ein Grundentgelt iHv. 3.500,00 Euro gezahlt hatte, vereinbarte sie mit diesem ab dem 1. Juli 2018 eine Erhöhung des Grundentgelts auf 4.000,00 Euro brutto. Zur Begründung berief sie sich ua. darauf, dass der Arbeitnehmer einer ausgeschiedenen, besser vergüteten Vertriebsmitarbeiterin nachgefolgt sei. Ab dem 1. August 2018 zahlte die Beklagte dem männlichen Arbeitnehmer ein tarifvertragliches Grundentgelt nach derselben Entgeltgruppe wie der Klägerin, das sich in Anwendung der „Deckelungsregelung“ des § 18 Abs. 4 des Haustarifvertrags auf 4.120,00 Euro brutto belief. Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin von der Beklagten die Zahlung rückständiger Vergütung für die Zeit von März bis Oktober 2017 iHv. monatlich 1.000,00 Euro brutto, rückständige Vergütung für den Monat Juli 2018 iHv. 500,00 Euro brutto sowie rückständige Vergütung für die Zeit von August 2018 bis Juli 2019 iHv. monatlich 500,00 Euro brutto. Sie hat die Auffassung vertreten, die Beklagte müsse ihr ein ebenso hohes Grundentgelt zahlen wie ihrem fast zeitgleich eingestellten männlichen Kollegen. Dies folge daraus, dass sie die gleiche Arbeit wie ihr männlicher Kollege verrichte. Da die Beklagte sie beim Entgelt aufgrund des Geschlechts benachteiligt habe, schulde sie ihr zudem die Zahlung einer angemessenen Entschädigung iHv. mindestens 6.000,00 Euro. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte vor dem Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts ganz überwiegend Erfolg. Die Beklagte hat die Klägerin in der Zeit von März bis Oktober 2017 sowie im Juli 2018 dadurch aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt, dass sie ihr, obgleich die Klägerin und der männliche Kollege gleiche Arbeit verrichteten, ein niedrigeres Grundentgelt gezahlt hat als dem männlichen Kollegen. Die Klägerin hat deshalb einen Anspruch nach Art. 157 AEUV*, § 3 Abs. 1** und § 7 EntgTranspG*** auf das gleiche Grundentgelt wie ihr männlicher Kollege. Der Umstand, dass die Klägerin für die gleiche Arbeit ein niedrigeres Grundentgelt erhalten hat als ihr männlicher Kollege, begründet die Vermutung nach § 22 AGG****, dass die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts erfolgt ist. Der Beklagten ist es nicht gelungen, diese Vermutung zu widerlegen. Insbesondere kann sich die Beklagte für den Zeitraum von März bis Oktober 2017 nicht mit Erfolg darauf berufen, das höhere Grundentgelt des männlichen Kollegen beruhe nicht auf dem Geschlecht, sondern auf dem Umstand, dass dieser ein höheres Entgelt ausgehandelt habe. Für den Monat Juli 2018 kann die Beklagte die Vermutung der Entgeltbenachteiligung aufgrund des Geschlechts insbesondere nicht mit der Begründung widerlegen, der Arbeitnehmer sei einer besser vergüteten ausgeschiedenen Arbeitnehmerin nachgefolgt. Für den Zeitraum ab dem 1. August 2018 ergibt sich der höhere Entgeltanspruch der Klägerin bereits aus dem Tarifvertrag. Entgegen der Auffassung der Beklagten findet die „Deckelungsregelung“ in § 18 Abs. 4 Haustarifvertrag auf die Klägerin keine Anwendung, weil diese zuvor kein tarifliches, sondern ein einzelvertraglich vereinbartes Entgelt erhalten hat. Der Senat hat dem auf Zahlung einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG***** gerichteten Antrag der Klägerin teilweise entsprochen und dieser eine Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund des Geschlechts iHv. 2.000,00 Euro zugesprochen.
Aufhebungsvertrag - Gebot fairen Verhandelns
Ein Aufhebungsvertrag kann unter Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns zustande gekommen sein. Ob das der Fall ist, ist anhand der Gesamtumstände der konkreten Verhandlungssituation im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden. Allein der Umstand, dass der Arbeitgeber den Abschluss eines Aufhebungsvertrags von der sofortigen Annahme seines Angebots abhängig macht, stellt für sich genommen keine Pflichtverletzung gemäß § 311 Abs. 2 Nr. 1 iVm. § 241 Abs. 2 BGB dar, auch wenn dies dazu führt, dass dem Arbeitnehmer weder eine Bedenkzeit verbleibt noch der Arbeitnehmer erbetenen Rechtsrat einholen kann. Die Parteien streiten über den Fortbestand ihres Arbeitsverhältnisses nach Abschluss eines Aufhebungsvertrags. Am 22. November 2019 führten der Geschäftsführer und der spätere Prozessbevollmächtigte der Beklagten, der sich als Rechtsanwalt für Arbeitsrecht vorstellte, im Büro des Geschäftsführers ein Gespräch mit der als Teamkoordinatorin Verkauf im Bereich Haustechnik beschäftigten Klägerin. Sie erhoben gegenüber der Klägerin den Vorwurf, diese habe unberechtigt Einkaufspreise in der EDV der Beklagten abgeändert bzw. reduziert, um so einen höheren Verkaufsgewinn vorzuspiegeln. Die Klägerin unterzeichnete nach einer etwa zehnminütigen Pause, in der die drei anwesenden Personen schweigend am Tisch saßen, den von der Beklagten vorbereiteten Aufhebungsvertrag. Dieser sah ua. eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30. November 2019 vor. Die weiteren Einzelheiten des Gesprächsverlaufs sind streitig geblieben. Die Klägerin focht den Aufhebungsvertrag mit Erklärung vom 29. November 2019 wegen widerrechtlicher Drohung an. Mit ihrer Klage hat die Klägerin ua. den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses über den 30. November 2019 hinaus geltend gemacht. Sie hat behauptet, ihr sei für den Fall der Nichtunterzeichnung des Aufhebungsvertrags die Erklärung einer außerordentlichen Kündigung sowie die Erstattung einer Strafanzeige in Aussicht gestellt worden. Ihrer Bitte, eine längere Bedenkzeit zu erhalten und Rechtsrat einholen zu können, sei nicht entsprochen worden. Damit habe die Beklagte gegen das Gebot fairen Verhandelns verstoßen. Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben, das Landesarbeitsgericht hat sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte vor dem Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Auch wenn der von der Klägerin geschilderte Gesprächsverlauf zu ihren Gunsten unterstellt wird, fehlt es an der Widerrechtlichkeit der behaupteten Drohung. Ein verständiger Arbeitgeber durfte im vorliegenden Fall sowohl die Erklärung einer außerordentlichen Kündigung als auch die Erstattung einer Strafanzeige ernsthaft in Erwägung ziehen. Ebenso ist das Landesarbeitsgericht auf der Grundlage der vom Senat in der Entscheidung vom 7. Februar 2019 (- 6 AZR 75/18 -) entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung des in der Revisionsinstanz nur eingeschränkten Prüfungsumfangs zutreffend zu dem Schluss gekommen, dass die Beklagte nicht unfair verhandelt und dadurch gegen ihre Pflichten aus § 311 Abs. 2 Nr. 1 iVm. § 241 Abs. 2 BGB verstoßen hat. Die Entscheidungsfreiheit der Klägerin wurde nicht dadurch verletzt, dass die Beklagte den Aufhebungsvertrag entsprechend § 147 Abs. 1 Satz 1 BGB nur zur sofortigen Annahme unterbreitet hat und die Klägerin über die Annahme deswegen sofort entscheiden musste.
Quelle: Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 24. Februar 2022 - 6 AZR 333/21 -